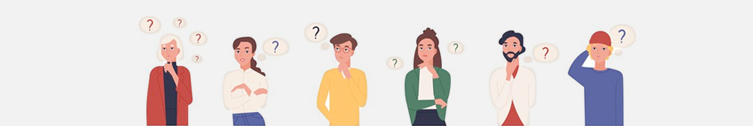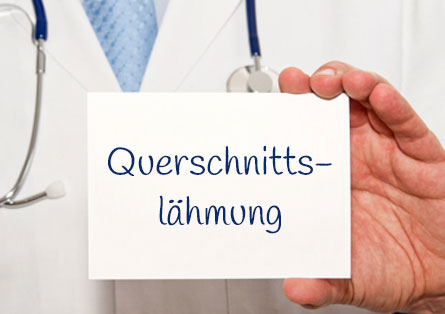- Kontinenz-Expertin
- Examinierte Krankenschwester
- Fachkraft für Kontinenzförderung, Pflegedienstleitung, Case-Managerin
- Wundexpertin ICW
Was ist Reflexinkontinenz?
Reflexinkontinenz ist eine Form der neurogenen Blase, die auf einer Überaktivität des Schließmuskels der Blase, dem Detrusor, beruht.
Der Urinabgang ist gestört durch Schädigung oder Erkrankung der Strukturen, die die Nervenimpulse aus Gehirn oder Rückenmark auf die Blase übertragen. Die Kontrolle über die willkürliche Blasenentleerung geht somit verloren. Willentlich lässt sich die Miktion weder einleiten noch unterbrechen.
Unterschieden wird zwischen spinaler und supraspinaler Reflexinkontinenz. Die Folgen sind je nach Ort der Schädigung der Nerven unterschiedlich. Bei der spinalen Form, die die Folge einer Verletzung oder neurologischen Erkrankung des Rückenmarks ist, sind die Nervenverbindungen vom Rückenmark zum Gehirn unterbrochen. Die Blase kann nicht mehr willentlich geleert werden. Bei der supraspinalen Form sind Störungen der Hirnleistungen der Grund für einen Verlust der willentlichen Blasenkontrolle.
Bei Patienten mit komplettem Querschnitt unterscheidet man in Abhängigkeit vom Ort des Defektes des Rückenmarks zwischen spastischer Blase, hyperaktiver Blase und schlaffer areflexiver Blase. Bei der spastischen Blase ist der äußere Schließmuskel trotz Entleerungsreflex angespannt, die Blase ist angespannt und der Druck steigt nach oben. Und damit kann es mittelfristig durch einen vesikorenalen Reflux (unphysiologischer Rückfluss von Harn aus der Blase über die Harnleiter in die Nierenbecken) zu einer Gefährdung der Nierenfunktion kommen. Bei der schlaffen Blase kommt es zu keinen Kontraktionen. Der Urin steht in der Blase und das Risiko für Infektionen steigt.